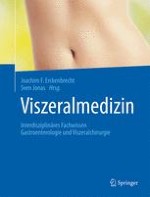2015 | OriginalPaper | Buchkapitel
15. Funktionserkrankungen von Dünn- und Dickdarm
verfasst von : Joachim F. Erckenbrecht, Prof. Dr. med.
Erschienen in: Viszeralmedizin
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Zusammenfassung
-
Funktionserkrankungen: Zusammenfassung von Symptomen, für die die übliche morphologische (Bildgebung durch Endoskopie, CT, MRT oder konventionelle Radiologie) und laborchemische Diagnostik kein pathologisches Korrelat liefert. Wegen dieses Mangels an „Darstellbarkeit“ häufig fälschlicherweise Annahme, dass es sich um psychogene oder psychosomatische Störungen handeln würde.